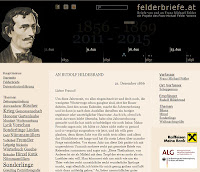Als Ende des 19. Jahrhunderts das Saccharin erfunden wurde, sorgte die bedrohte Zuckerindustrie dafür, dass die Einfuhr dieses billigen Süßstoffes für Deutschland, Österreich und Böhmen 1902 per Gesetz verboten wurde.
So blieb den Schmugglern nichts anderes übrig, als von der Schweiz aus das leicht transportierbare Saccharin über die Grenzen zu bringen. Saccharin, Zucker, Mehl, Tabakwaren waren lange Zeit eines der Hauptschmuggelgüter an der Grenze Vorarlbergs zu der Schweiz und Liechtenstein. Schmuggel war im Grenzland immer ein Thema, nicht nur in Kriegs- und Notzeiten. Anders verhält es sich allerdings, damit als der Schmuggel zur Finanzierung nationalsozialistischer Wiederbetätigung dienen sollte.
NS-Wiederbetätigung: Saccharinschmuggel über Vorarlberg. Im Herbst 1947 hoben die österreichischen Sicherheitsbehörden einen Schleichhändlerring aus. Saccharin aus der Schweiz wurde in großen Mengen nach Österreich geschmuggelt und am Schwarzmarkt verkauft. Ein Teil des Erlöses diente den Zwecken eines „Ordens”, der nationalsozialistisches Gedankengut aufrechterhalten und weiterführen sollte. Es war nicht wirklich erstaunlich, dass viele der Hauptverdächtigen sich aus HJ-Führern oder subalternen Funktionären des Dritten Reiches rekrutierten. Das mittlere Management des vergangenen Regimes, das seine Posten 1945 eingebüßt hatte und zum Teil im Untergrund lebte, fand in derlei Aktivitäten ein Betätigungsfeld.
Kopf der Untergrundorganisation war der Grazer Kaufmann Theodor Soucek. Ihr Ziel war es, „dem großen Kreis, der durch das NS-Gesetz Ausgeschlossenen die Möglichkeit zur Rückkehr und Hinwendung zur Politik zu verschaffen”. Soucek wurde zwar als Wiederbetätiger zum Tode verurteilt, doch bereits 1951 begnadigt. Die Organisation des Schmuggels aus der Schweiz wurde von Anton Schnert aus Tirol geleitet, der als Motive für sein Handeln nicht nur persönliche Bereicherung nannte, sondern auch den Versuch, Österreich bis zu seinem neuerlichen Untergange zu schaden.
Der Vorarlberger Landeshauptmann Ilg hingegen wunderte sich über die "Willkür" der französischen Besatzungsmacht, als im Sommer 1947 drei französische Soldaten in einer Wohnung einer Lustenauerin in Bregenz Saccharin im Wert von 40.000.- Schilling beschlagnahmten ohne irgendwelche Amtshandlungen einzuleiten.
Am 19. Juni 1946 wurden nach den Akten der Stadtpolizei am Bahnhof Dornbirn zwei Personen mit größeren Mengen Saccharin festgenommen und zuvor wurden bereits mehrere Personen wegen Saccharinschleichhandels festgesetzt. Bei einer Fahrt transportierte man 80 bis 200 Großpackungen im Wert von bis zu 54.000 Schilling. Das Liechtensteiner Volksblatt meldete bereits am 29.8.1946, dass es der Zollwache in Hohenems gelungen sei, einen Schmuggler festzunehmen, der im Besitze von 495 Schächtelchen Saccharin, 143 Päckchen Pfeifentabak und 10 000 Zigaretten war.
Kaffee nach Lindau. Von einer anderen Bedienung des deutschen Schwarzmarktes mit Kaffe berichtet das Magazin "Der Spiegel" 28/1951 durch einen Vorarlberger. Der Schmuggel über Lindau war wegen des besonderen Status von Lindau in der Nachkriegszeit besonders lukrativ. Was der damals 25jährige, in Moskau geschulte Lokalredakteur (Anmerkung: Erich Grabher) der 'Vorarlberger (KP-)Zeitung' vorbrachte, schien den Lindauern ein Allheilmittel zu sein:
- Um die Schmuggler in Sicherheit zu wiegen, sollten zunächst ein paar größere Kaffee-Sendungen ungehindert und unverzollt über die Grenze bis zu den Abnehmern gelangen. Dabei sollten die Schieber den Eindruck gewinnen, ihren Spezialisten sei es gelungen, die Zollbeamten zu bestechen, und ein risikoloser Weg in das Schieber-Dorado Westdeutschland sei geöffnet.
- *Nach diesen ersten "Toleranz-Partien" sollten die Schieber veranlaßt werden, eine besonders große Sendung zu starten, die dann vom Zoll beschlagnahmt werden solle. Durch eine solche Großbeschlagnahme würden die Schieber entscheidend getroffen werden. Die Zöllner hätten nun die Möglichkeit, mit ihren Erfolgen einen guten Eindruck zu machen. Der Lindauer Staatskasse, zu deren Gunsten der Kaffee dann versteigert werde, falle der Versteigerungserlös (Warenwert plus Zoll und Steuer, bei 10 Tonnen Rohkaffee etwa 160 000 D-Mark) zu."
Umgekehrter Schmuggel: Deutsche Gäste auf die Heilbronner Hütte. Mit dem Stichtag vom 1. Juni 1948 waren durch die französischen Militärbehörden in ganz Vorarlberg 66 Hotels total beschlagnahmt, weitere 41 zum Teile. 101 Villen und Häuser zur Gänze und 6 teilweise in Anspruch genommen, wozu noch 299 Wohnungen und 284 Einzelzimmer kommen. Von den völlig beschlagnahmten Hotels befinden sich allein 28 im Kleinen Walsertal und 16 im Bezirk Bludenz, also in Gebieten, die für en Fremdenverkehr des Landes lebenswichtig sind. Die Gesamtzahl der requirierten Objekte betrug noch im Sommer 1948 797, für ein kleines Land wie Vorarlberg eine bedrückend hohe Zahl und für den ohnedies schwächelnden Fremdenverkehr eine Belastung. Zudem war an einen deutsch-österreichischen Reiseverkehr noch überhaupt nicht zu denken. Sowohl die militärischen Behörden als auch die zwischenstaatlichen Regelungen hinderten noch deutsche Urlaubsgäste nach Vorarlberg zu kommen. Es gab nur ganz wenige Ausnahmen, wie etwa Todesfälle und schwerwiegende Erkrankungen.
Das Magazin "Der Spiegel" Nr.14/1950 berichtet von einem "Universalgenie" Egon Breiß (müsste wohl Preuß heißen) aus Bregenz, dem es gelungen war, Gäste aus Deutschland auf die Heilbornner Hütte zu schmuggeln:
"Als Breiß im Oktober 1945 die "Heilbronner Hütte" (Vorarlberg) übernahm, kam Betrieb in das 2300 Meter hoch gelegene Haus mit fließendem Wasser und elektrischem Licht. Da oben ruhten sich Wiens Schwarzhändler von ihren Geschäften aus. Breiß hielt auf Renommee: Die Frage nach Lebensmittelmarken wurde in seinem Hause nicht gestellt.
Dafür stellten die Franzosen die Frage nach den Eigentumsrechten. Dabei kam heraus, dass die Hütte 1926 mit einem Kostenaufwand von über 100.000 RM von der Sektion Heilbronn des deutschen Alpenvereins erbaut war. Der Heilbronner Hütte erging es wie der Ulmer, Reutlinger und Wiesbadener Hütte. Als deutsches Eigentum in Österreich verfiel sie der Beschlagnahme durch die Besatzungsmacht.
Breiß fand trotzdem neue Wege zum Geld. Bei Dr. Schmid von Wellenbusch in Innsbruck, Vorsitzender vom österreichischen Alpenverein, und Professor Dr. Busch, Chef der Verwaltung deutscher Sektionshütten im westalliierten Österreich, erwarb er sich durch beharrliches Antichambrieren die vorläufige Genehmigung zur Weiterführung der Heilbronner Hütte.
Dann startete Breiß seinen illegalen deutsch-österreichischen Fremdenverkehr."
[Zeitreiseführer
#Vorarlberg ]⇒