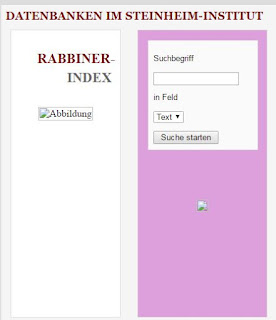Constantin Wurzbach. Lexikograf und Schriftsteller. Seit 1854: Constantin Wurzbach Edler von Tannenberg; seit 1874: Constantin Wurzbach Ritter von Tannenberg; (geb. Laibach, Krain, heute Ljubljana, Slowenien, am 11. April 1818; gest. Berchtesgaden, Bayern, am 17. August 1893)
Der Sohn eines Advokaten, publizierte bereits als Gymnasiast in Laibach in verschiedenen Zeitschriften. Er studierte 1835 bis 1837 Rechtswissenschaft an der Universität Graz (Steiermark), wo er auch gute Kontakte zu den dortigen Schriftstellern unterhielt. 1837 bis 1843 war er beim Militär – zuletzt im Rang eines Unterleutnants der Infanterie – in Krakau (seit 1838 Galizien; Kraków, Polen) und seit 1841 in Lemberg (Galizien; L’viv / Львів, Ukraine). Daneben studierte er seit 1841 Philosophie an der Universität Lemberg, wo er 1843 zum Doktor der Philosophie (Dr. phil.) promoviert wurde. 1843 trat er vom Armee- in den Zivildienst über und wurde Skriptor (wissenschaftlicher Beamter) an der Universitätsbibliothek in Lemberg. 1847 bis 1848 war er Redakteur der »Gazeta Lwówska« (Lwów [L’viv / Львів]; Lemberger Zeitung) und Vertrauter des Gouverneurs von Galizien Franz Grafen Stadion (1806–1853).
1848 übersiedelte Wurzbach nach Wien, wo er Bibliothekar an der kaiserlichen Hofbibliothek wurde, blieb aber weiterhin de facto für Franz Grafen Stadion tätig, der mittlerweile Innenminister in Wien war. 1849 wurde Wurzbach Bibliothekar (eigentlich Vorstand) der Administrativen Bibliothek des Ministeriums des Innern in Wien, zuletzt im Rang eines k(aiserlich) k(öniglichen) Hof- und Regierungsrats. 1874 wurde er zwecks Vollendung seines sechzigbändigen »Biographischen Lexikons des Kaiserthums Österreich« (1856–1891; enthält 24.254 Biographien) dienstfrei gestellt (1891 pensioniert) und lebte seither in Berchtesgaden (Bayern).
Constantin von Wurzbach, der auch als Lyriker und Prosaist hervortrat, gilt heute als der bedeutendste lexikografische Biograf des Kaisertums Österreich. Am 18. August 1893 starb er in seinem Wohnhaus in Berchtesgaden. Dem Grabstein wurde jedoch nicht jene Inschrift verpasst, die Wurzbach in seinem Testament vom 23. März 1887 ausgesprochen hat: Es möge auf seinem Grabstein eine ein Buch zernagende Maus eingemeißelt werden mit der Inschrift:
Ein Mäuschen ohne alle Stärke
bezwingt das größte aller Werke.
Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. Das Werk enthält 24.254 Biographien, davon 21.406 von in den verschiedenen Kronländern des Kaiserstaates Geborenen, 1.129 von in Österreich "denkwürdig"gewordenen Ausländern und 1.719 von im Ausland denkwürdig gewordenen Österreichern. Dazu kommen 347 Stammtafeln.
Welchen Wert hat ein solches Lexikon heute noch über den wenig verdienstvollen, dass es selber Teil der Geschichte geworden ist? Suchen wir einen Vorarlberger im Lexikon und vergleichen die Angaben mit unserem heutigen Wissen. Auch wenn das Werk 24.254 Biographien enthält, dann muss es schon ein ganz "großer" Vorarlberger sein, wenn er sich unter den unbestreitbaren Größen in den verschiedenen Kronländern des Kaiserstaates behaupten muss. Im Band 40 haben wir einen solchen gefunden: Salomon Sulzer
Wurzbachs Verdienste um das Bibliothekswesen: Er entwarf die Instruktion für den Bibliotheksdienst, er ordnete und katalogisierte die durch die Pflichtexemplare rasch anwachsenden Bestände der kaiserlichen Hofbibliothek , er baute die an Umfang und Vollständigkeit als einzigartig bezeichnete Sammlung von Flugschriften und Plakaten aus 1848/49 aus. Seinem ausgeprägten Hang zum Sammeln und Ordnen kamen auch seine aus der Bibliotheksarbeit erwachsenen bibliographischen Publikationsreihen entgegen: Die für 1853-1855 erschienene "Bibliographisch-statistische Übersicht der Literatur des östreichischen Kaiserstaates" etwa begründete die Literaturstatistik in Österreich; ihre bahnbrechende Bedeutung für Europa wurde auf internationalen statistischen Kongressen anerkannt.
Das Lexikon auch heute noch zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel historischer und kulturhistorischer Forschung, als eine Art Steinbruch der Biographik, sei es in den Werks- und Quellenverzeichnissen, sei es in den Mitteilungen von biographischen Fakten und Tatsachen. Auch wenn seine Schwächen nicht übersehen werden sollten (Wurzbach ist auf wenigen Gebieten Fachmann, sicher nicht auf den Gebieten Naturwissenschaft, Technik, Industrie und das Problem seines politischen Standpunkts: Wurzbach hat alle Habsburger jedoch nur einen einzigen Sozialisten aufgenommen hat, nämlich Milan Subaríc mit der Berufsbezeichnung "sozialistischer Wanderprediger") darf doch bemerkt werden, dass die Leistung dieses Lexikons nach heutigen Vorstellungen für einen Einzelnen eine geradezu unvorstellbare Leistung ist.
Wie er das zustande gebracht hat, sagt er selbst: "Ordnung war das Hauptgeheimnis meiner Arbeit. Was ich las, notierte ich und brachte es in alphabetische Ordnung ... Dabei war ich nie müßig, ich schlief wenig. Morgens um 7 Uhr war ich bei der Arbeit und arbeitete in der Regel bis 2 Uhr; dann nahm ich ein Mittagmahl und trank nie Wein, machte nie ein Mittagsschläfchen; mir tat es um die Zeit leid, lebte überhaupt sehr mäßig. Abends um 9 Uhr bis halb 12 Uhr bereitete ich mich für die Arbeit des nächsten Morgens vor, so daß ich ganz vorbereitet zum Arbeitspult kam und mich bald mit den Quellen, die oft freilich einen, auch zwei und drei große Tische bedeckten, zurechtfand."
- Digital: Biographische Lexikon des Kaiserthums Österreich (60 Bände, 1856-91)
- Elisabeth Lebensaft – Hubert Reitterer: WURZBACH–ASPEKTE - Sonderabdruck aus Wiener Geschichtsblätter 47 (1992), Heft 1, 277 KB, 15 S., pdf, 1999
- Salomon Sulzer in: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich Vierzigster Teil
- [Google Search] SALOMON SULZER im Biographischen Lexikon des Kaiserthums Österreich
- Nütze auch diesen obenstehenden Link „[Google Search] ⇒ “. Er liefert allenfalls einen aktuelleren Link oder im Falle einer Verwaisung einen neueren und aktuelleren. Fast immer aber hilft er auch für zusätzliche oder aktuellere Infos!
- TIPP: Das ⇒ #Vorarlberger Bloghaus verlinkt interessante Weblogs.
- Beachte dort auch weitere Informationen zum Thema unter "Nachschlagen A-Z".
- 2.7.23 [Letzte Aktualisierung, online seit 25.9.10]