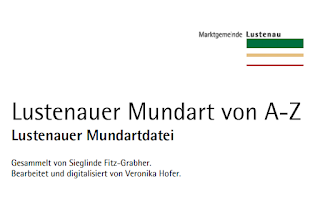Unter BIOTOP wird in diesem Inventar der Standort einer in sich mehr oder weniger geschlossenen Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren verstanden. Klassisches Beispiel für einen Biotop wäre etwa ein Weiher, es kann aber genauso ein Waldstück, eine Wiese etc. sein.
Häufig bilden einzelne Biotope in sich zusammenhängende Komplexe aus, wie etwa ein Quellmoor mit der Quelle als Einzelbiotop und den angrenzenden nassen „Quellsümpfen“. Dann wird von BIOTOPKOMPLEX gesprochen. Besonders Großtiere haben Biotop übergreifende Reviere, oder ganze Landschaftsteile bilden einen geschlossenen und vielfältigen Lebensraum von besonderer Schutzwürdigkeit (z.B. Kanisfluh). In diesem Fall wird von einem GROSSRAUMBIOTOP gesprochen.
Grundsätzlich ist Biotop ein allgemeiner Begriff. Ein Biotop muss nicht von vorneherein besonders oder überhaupt schutzwürdig sein. Auch ein Garten ist z.B. ein Biotop mit Kultur- und Wildpflanzen und einer großen Zahl an Tieren - beliebte und unbeliebte - sei es im Boden oder an Pflanzen.
Gemeindebericht Lustenau. Die Gemeinde Lustenau erstreckt sich von der Schweizer Landesgrenze am Rhein bis zur Dornbirner Ach im Nordosten, dem Rheintal-Binnenkanal und dem Landgraben-Dornbirn im Osten, sowie dem Landgraben –Hohenems im Süden. Das Gemeindegebiet von Lustenau liegt im Bereich des Rheintalgrabenbruchs, einer jüngeren mit Lockersedimenten gefüllten Wanne, welchen die geografische Grenze zwischen Ost- und Westalpen darstellt. Im Bereich Rheindorf lag vor rund 4000 Jahren das Delta des Alpenrheins in den Bodensee (Lustenauer Delta).
- Gemeindefläche 2226,54 ha
- Biotopfläche Großraumbiotope 309,48 ha
- Biotopfläche Kleinraumbiotope 167,83 ha
- innerhalb von Großraumbiotope 122,83 ha
- Biotopfläche Gemeinde 354,48 ha
Während sich das Rheindelta durch Anlandungen weiter nach Norden vorschob, entstanden im heutigen Lustenauer Gemeindegebiet flache Restseen, die sich mit Schwebstoffe des Rheins füllten und schließlich verlandeten. Im Bereich dieser wasserstauenden Seetone, bildeten sich die auch heute noch erhaltenen Moorflächen und Streuwiesen. Die Verlandungen in Lustenau bestehen entlang des Rheins aus lehmigem Feinsand, in der Gemeindemitte aus Lehm und an den östlichen Gemeindegrenzen aus Torf. Die Gemeinde liegt auf 400m Seehöhe. Insgesamt wurden in der Gemeinde 2 Großraumbiotope und 15 Kleinraumbiotope
ausgewiesen. Da die Biotopausstattung der Gemeinde nahezu ausschließlich aus Rieden besteht, dominieren Pfeifengraswiesen und Röhrichte.
Drei besondere "Kostbarkeiten" aus den Lustenauer Biotopen:
- Obere Mähder West (Biotop 30304) 17 ha. Äußerst artenreiche, basische Pfeifengraswiesen, Kopfbinsenmoore und Hochstaudenfluren mit zahlreichen seltenen und gefährdeten Arten innerhalb des FFH-Gebietes „Gsieg-Obere Mähder“. Die Oberen Mähder West liegen in der Fläche westlich der L203, mit der L45 im Norden und dem Binnendamm im Westen. Es handelt sich um eine typisch ausgeprägte, vielfältige Streuwiesenlandschaft, die insgesamt bemerkenswert artenreich entwickelt ist. Es dominieren basenreiche Pfeifengraswiesen (Selino-Molinietum) in teils trockener, teils nasser Ausbildung, weiters sind Kopfbinsenrasen (Schoenetum ferruginei) ausgebildet, sowie Baldrian-Mädesüß-Hochstaudenfluren (Valeriano-Filipenduletum). Einzelne Strauchgruppen wirken landschaftlich prägend auf die Riedwiesenlandschaft.
- Gsieg-Nord (Biotop 30308) 39,74 ha. Ausgedehnter Streuweisen/Moorwiesenkomplex, der als eine der ökologisch bedeutendsten Flächen im mittleren Alpenrheintal anzusehen ist. Die Fläche wird im Nordteil von basenreichen Pfeifengraswiesen dominiert, im Südteil von basenarmen. Besonders hervorzuheben sind größerflächige Torfmoorschlenken und Kalkreiche Niedermoore.
Die Biotopfläche ist Teil des Natura 2000-Gebietes "Gsieg-Obere Mähder". Durch die Großflächigkeit, die Höhenunterschiede und die Feuchtigkeitsverhältnisse haben sich hier eine Reihe unterschiedlichster Pflanzengesellschaften ausgebildet, von denen die meisten als stark gefährdet angesehen werden müssen. So herrschen im nördlichen Teil basenreiche Pfeifengraswiesen (Selino-Molinietum) vor, in die immer wieder Binsen-Pfeifengraswiesen mit Trichophorum cespitosum (Junco-Molinietum) und Schnabelsimsengesellschaften (Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae) eingelagert sind. Im Nordosten des Gebietes haben sich Kopfbinsenbestände (Schoenetum ferruginei) erhalten. Nach Süden zu übernehmen die Binsen-Pfeifengraswiesen die Vorherrschaft. In den südlichsten Anteilen und in den Grenzbereichen zum Rheintal-Binnenkanal treten verstärkt Nährstoffzeiger auf, bzw. sind die Bestände durch Schilf und Riesen-Goldrute beeinträchtigt, was wohl auf Effekte der Grundwassersenkung in der direkten Umgebung des Binnenkanals zurückzuführen ist.
- Auer Ried-Süd (Biotop 30315) 20,08 ha. Schöner und großflächiger, zusammenhängender Feuchtgebietskomplex im südlichen AuerRied (auch als Schweizer Ried bezeichnet) mit einer der schönsten Riedwiesen in der weiteren Umgebung mit einem reichen Vorkommen der Sumpfgladiole. Die Flächen des Biotops sind Teil des Natura 2000-Gebietes "Soren, Gleggen - Köblern, Schweizer Ried und Birken - Schwarzes Zeug". Bei der östlich des zentralen Riedwegs gelegenen Streuefläche handelt es sich um ein eher artenarmes Hochstaudenried mit vorherrschendem Schilf, Mädesüß und Rohrpfeifengras. Gegen Westen mit Abnahme des Schilfes und Zunahme des Pfeifengrases werden die Bestände deutlich artenreicher. Es handelt sich um wechselfeuchte, artenreiche Pfeifengras-Schilfrieder. In trockeneren Abschnitten, die ausgesprochen viele Arten aufweisen, gedeihen schöne Vorkommen der Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris). In feuchten Mulden kommen Binsennieder und Übergänge zu Schilfröhrichten vor. Die Wiesen besitzen nicht zuletzt dank ihrer Ausdehnung, auch faunistisch eine hervorragende Bedeutung. Es dient vielen Riedbrütern, die überall in Mitteleuropa äußerst gefährdet sind, als Brut- oder Nahrungsplatz.
[Zeitreiseführer #Vorarlberg ]⇒
Ein schneller Blick auf den Inhalt:
Inhalt
Seite
Einführung 5
– Kurzer Rückblick und Ausblick 5
– Was ist ein Biotop? 6
– Wann gilt ein Biotop als BESONDERS SCHUTZWÜRDIG? 7
Gemeindebericht 9
– Allgemeine Angaben zur Gemeinde 9
– Biotopausstattung 10
– Schutzstatus der Biotopflächen 12
– Verbindung zu angrenzenden Gemeinden 13
– Die drei Kostbarkeiten der Gemeinde 14
Obere Mähder West (Biotop 30304) 14
Gsieg-Nord (Biotop 30308) 16
Auer Ried-Süd (Biotop 30315) 18
– Kurzdarstellung der weiteren Biotopflächen 20
Alt-Rheingebiet (Biotop 30301) 20
Gsieg-Süd (Biotop 30302) 22
Großraumbiotop Schweizer Ried - Obere Mähder - Gsieg (Biotop 30303) 24
Obere Mähder-Mitte (Biotop 30305) 25
Obere Mähder-Binnenkanal (Biotop 30306) 27
Obere Mähder-Ost (Biotop 30307) 28
Brändlis Wies (Schweizerried nördlich L45) (Biotop 30309) 29
Weismähder (Biotop 30310) 31
Alberried (Biotop 30311) 32
Oberes Heuried (Biotop 30312) 33
Unteres Heuried (Biotop 30313) 34
Streuried (Biotop 30314) 35
Auer Ried-Nord (Biotop 30316) 36
Großraumbiotop Natura-2000 Gebiet "Soren, Gleggen - Köblern, Auer
Ried und Birken - Schwarzes Zeug" (Biotop 30317) 37
– Gefährdungen 38
– Empfehlungen für Schutz und Erhalt 40
Was wurde bisher getan? 40
Was kann die Gemeinde tun für 41
Was kann der Einzelne tun für 43
Artenliste 45