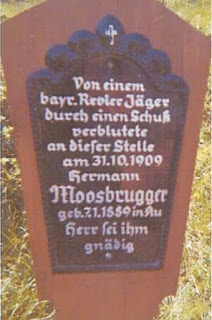Im Österreich der Zwischenkriegszeit existierte eine dem deutschnationalen Spektrum zugeordnete Bauernpartei. Sie fußte auf christlicher Grundlage, sprach sich aber dezidiert gegen die politische Instrumentalisierung von Religion aus. Ansonsten positionierte sie sich als großdeutsch eingestellte agrarische Wirtschaftspartei1 und trat mit Vehemenz für die berufsständische Gliederung des Staates ein. Deren Vorarlberger Landesparteileitung sprach davon, eine christlich-nationale und wirtschaftlich-konservative Partei zu sein. Ihr Gruß lautete: „Für Halm und Ar, für Gott und Vaterland“.
Der Name dieser Partei? Heute ist er weitgehend vergessen: „Landbund“. Der Landbund (LBd) wurde 1919 als Deutsche Bauernpartei gegründet und war eine politische Partei der freisinnigen oder evangelischen Bauern der Steiermark, Kärntens und Oberösterreichs. Sie trat für den „Anschluss“ ans Deutsche Reich ein und bekannte sich zum Antimarxismus und zum Ständegedanken, lehnte aber die Heimwehr ab.
1927 bis 1933 gehörte sie der Regierung an und stellte den Vizekanzler oder Innenminister. Ab 1930 bildete sie mit der Großdeutschen Volkspartei die Wahlgemeinschaft „Nationaler Wirtschaftsblock“ (nach dem Listenführer Johann Schober auch „Schoberblock“ genannt), die 1934 im Zuge der Etablierung des Austrofaschismus aufgelöst wurde.
Obwohl bei der Bildung der provisorischen Regierung 1945 ein Sitz für den Landbund vorgesehen war, fand die Partei in der Zweiten Republik keine Fortsetzung mehr. Die ehemaligen Landbund-Führer traten in die neu gegründete Österreichische Volkspartei ein.
[Zeitreiseführer
#Vorarlberg ]⇒
Lohnt sich ein Download? Ein schneller Blick auf den Inhalt:
Inhalt
Abkürzungen 7
1. Einleitung 9
2. Die Anfänge der „Grünen“ 11
3. Das „grüne“ Programm und seine Umsetzung 15
3.1 Dirigistische Wirtschaftsansätze versus Freies Wirtschaften 18
3.2 Der Außenhandel und die Zölle 23
3.3 Sozialpolitische Forderungen 26
3.4 Die Systemfrage 31
3.5 Die Anschlussoptionen 36
3.6 Der Antisemitismus 41
4. Die Organisation 47
4.1 Die Landesorganisation 47
4.1.1 Die Entwicklung auf Landesebene 47
4.1.1.1 Steter Wandel 47
4.1.1.2 Die Wahlen 1923 und ihre Folgen 52
4.1.1.3 Die Reorganisation 55
4.1.1.4 Der Eindruck täuscht 57
4.1.1.5 Prekäre Verhältnisse 59
4.1.2 Das Landessekretariat 60
4.1.2.1 Eine durchwachsene Bilanz 60
4.1.2.2 Finanzielle Zwänge 63
4.2 Die Gemeindeorganisation 66
4.2.1 Der Ortsgruppenkrösus 66
4.2.2 Organisatorische Hüllen 68
4.3 Die Bezirksorganisation 72
4.4 Der Junglandbund 75
4.5 Die „grünen“ Wehrformationen und die Heimwehren 81
4.5.1 Bundespolitischer Zwist 81
4.5.2 Das „Ländle“, sein Sonderweg und die Folgen 86
5. Die „Grünen“ im Vorarlberger Landtag 93
5.1 Die XI. Legislaturperiode 1919 – 1923 93
5.2 Die XII. Legislaturperiode 1923 – 1928 94
5.3 Die XIII. Legislaturperiode 1928 – 1932 96
5.4 Die XIV. Legislaturperiode 1932 – 1934 99
6. Verhältnisse der Parteien im Wandel 103
6.1 Die „Grünen“ und ihr christlichsoziales Pendant 103
6.1.1 Das große Ziel 103
6.1.2 Ein Verband und seine Wirkung 106
6.1.3 Ein zähes Ringen 107
6.1.4 Ein deutlicher Wandel 109
6.2 Die „Grünen“ und die GDVP 112
6.2.1 Ein erstes Abtasten 112
6.2.2 „Ländle“-Zufriedenheit 114
6.2.3 Bundesfrust 117
6.2.4 Der „Verband der Großdeutschen und des Landbundes“ 118
6.2.4.1 Die Übereinkunft 118
6.2.4.2 Das Zerwürfnis 119
6.2.4.3 Die Ausnahme Vorarlberg 121
6.2.5 Ein Wahlergebnis und seine Wirkung 125
6.2.5.1 Bundespolitische Zurückhaltung 125
6.2.5.2 Vorarlberger Hartnäckigkeit 128
6.2.6 Die Zäsur 1927 130
6.2.7 Der „Schoberblock“ 134
6.2.8 Ein umstrittener Parlamentsklub 140
6.2.9 Klimaveränderungen 142
6.2.10 Das Ende einer Ära 143
6.2.11 Ein abgekühltes Verhältnis 145
6.3 Die „Grünen“ und die NSDAP 148
6.3.1 Die 1920er Jahre 148
6.3.1.1 Eine österreichische Kleinstpartei – Farbe „Braun“ 148
6.3.1.2 Vorarlbergs kleine Grüppchen „Brauner“ 152
6.3.1.3 „Grüne“ Zurückhaltung 154
6.3.1.3.1 „Grünes“ Desinteresse und „blaue“ Ambitionen auf Bundesebene 154
6.3.1.3.2 „Blaue“ Initiativen und „grüne“ Einsilbigkeit auf Landesebene 158
6.3.2 Die 1930er Jahre 162
6.3.2.1 Österreichs Krisengewinnler – die „Braunen“ 162
6.3.2.2 Vorarlbergs „Braune“ – einen Schritt hinterher 164
6.3.2.3. Das Ende „grüner“ Zurückhaltung 166
6.3.2.3.1 Raue Töne 167
6.3.2.3.2 Ein bedeutender Wahlgang 169
6.3.2.3.3 Der Kampf geht weiter 177
6.3.2.3.4 Den „Braunen“ entgegen 179
7. Das Ende des Landbundes 185
7.1 Österreichs Landbund und der Weg ins politische Aus 185
7.2 Der Vorarlberger Landbund tritt ab 191
8. Zusammenfassung 195
Anhang 201
„Grüne“ Ortsgruppen in Vorarlberg 201
Vorarlberger Landtagswahlen – Ergebnisse 206
Nationalratswahlen – Ergebnisse Vorarlberg 207
Quellen- und Literaturverzeichnis 209
Register 219
Personenregister 219
Ortsregister 222